Wir feiern 100 Jahre Frauenwahlrecht. Die Autorin Annett Gröschner schreibt über vergangene und aktuelle Frauenbewegungen und ruft zu mehr Radikalität auf.
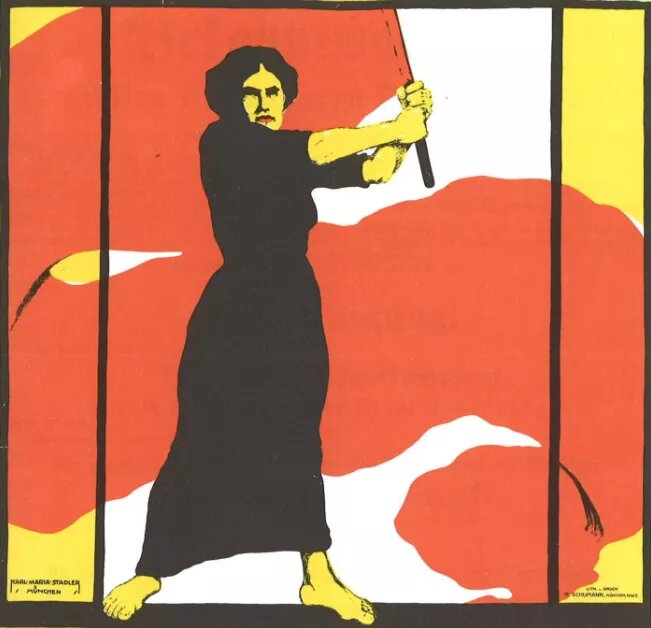
Die ersten waren die Bayern. Als am 7. November 1918 eine Gruppe um Kurt Eisner in den Landtag eindrang und den Freistaat Bayern proklamierte, gehörte die Einführung des Frauenwahlrechts zu den ersten Beschlüssen der Räteregierung. Fünf Tage später verfügte der Rat der Volksbeauftragten in Berlin:
„Alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften sind fortan nach dem gleichen, geheimen, direkten, allgemeinen Wahlrecht auf Grund des proportionalen Wahlsystems für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen.“
Bei der Wahl zur Deutschen Nationalversammlung am 19. Januar 1919 konnten Frauen zum ersten Mal ihre Stimme abgeben.
In Deutschland brauchte es also eine Revolution, um gleiche (Wahl-)Rechte für Frauen durchzusetzen. Das ist genau 100 Jahre her und war vorläufiger Endpunkt eines langen Kampfes. Schon nach der Revolution von 1848/49 hatten Frauenrechtlerinnen wie Louise Otto-Peters eine politische Teilhabe von Frauen gefordert.
Stattdessen stellten die Behörden in Preußen 1850 weibliche Personen auf eine Stufe mit Minderjährigen und Unmündigen – sie durften keine Vereine gründen und keine Versammlungen abhalten, das Wahlrecht war in weiter Ferne. Otto-Peters schrieb damals, dass die Frauen der „heiligsten Menschenrechte beraubt“ seien, zur Unmündigkeit verdammt. Aber sie meinte auch, dass die Frauen schon selbst aktiv werden müssten und dass ihre Teilnahme an den Interessen des Staates nicht nur ein Recht, sondern eine Pflicht sei.
Feministinnen neigen zu Vergesslichkeit
Vieles, was im 19. Jahrhundert von Frauen gedacht wurde, hat sich bis heute nicht erledigt, Feministinnen neigen leider zur Vergesslichkeit, was ihre Vorgängerinnen angeht. Eine wie Hedwig Dohm wäre immer noch Radikalfeministin. Die Angstphantasien ihrer Gegner haben in den heutigen Twittertweets von Maskulinisten und Rechtsextremen überlebt.
Die Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts kämpfte aber nicht nur um Wahlrecht und politische Mitbestimmung, sondern, und das wird gerne vergessen, auch um das Recht auf Bildung und eigenen Besitz.
Wäre das Wahlrecht für Frauen früher gekommen, hätten sich sicherlich die Vertreterinnen der bürgerlichen Frauenbewegung mit ihrer Forderung nach dem Dreiklassenwahlrecht durchgesetzt – volles Stimmrecht nur für Vermögende, nun aber für Frauen wie Männer. Auch heute gibt es Marktliberale, die für die Rückkehr des Zensuswahlrechts eintreten. Wer viel hat, soll nach ihrer Auffassung mehr zu sagen haben.
Demokratie ist nicht per se frauenfreundlich
Machen wir uns nichts vor, Demokratie ist nicht per se frauenfreundlich, es war immer eine Frage der Auslegung, wer die Freien und Gleichen waren. Gerade Länder, deren Namen mit dem Prinzip der Demokratie verbunden waren, brauchten am längsten, um das allgemeine Wahlrecht für Frauen durchzusetzen. In Frankreich kam es erst 1944, in Griechenland 1952, in der Schweiz sogar erst 1971, weil Männer per „Volks“-Entscheid darüber befanden, ob Frauen wählen dürfen. Und sie befanden eben jahrzehntelang, dass es ausreiche, wenn der Mann über die Geschicke der Nation bestimme.
Und wir wissen auch, dass Frauenwahlrecht alleine weder Diktaturen verhindert noch die Unterdrückung der Frau. Die Volkskammer der DDR hatte proportional immer mehr weibliche Abgeordnete als der Bundestag zur selben Zeit. 1949 standen 23,8 Prozent Frauen in der Volkskammer 6,8 Prozent im Deutschen Bundestag gegenüber. Nur blieben sie, wie die Männer, Marionetten der Macht, denn das Parlament hatte nicht viel zu entscheiden.
Den niedrigsten Frauenanteil an Abgeordneten des Deutschen Bundestages, 5,8 Prozent, gab es 1972, ausgerechnet in dem Jahr, das als demokratisches Lichtjahr der Bundesrepublik gilt. Vor allem Frauen hatten mit ihrer Stimme zur Mehrheit der Sozialdemokraten im Parlament beigetragen. Damals wehrten sich die Sozialdemokratinnen noch heftig gegen eine Quote. Auch 45 Jahre später ist die Bundesrepublik, was die Geschlechterparität angeht, im europäischen Vergleich weit abgeschlagen.
Aktuell: Ein Drittel Frauen im Bundestag
Bei der Bundestagswahl 2017 ist der Anteil von Frauen im Parlament auf 30,7 Prozent gesunken. Im gegenwärtigen Bundestag bestimmen zu 70 Prozent Männer Gesetze und Beschlüsse der gesamten Gesellschaft. Einen so starken Abfall von fast 6 Prozent hat es in der Geschichte des Deutsche Bundestages noch nie gegeben.
Die Gründe sind vielfältig, einer ist, dass die meisten Parteien immer noch Männer auf die aussichtsreicheren Listenplätze setzen und die Direktkandidaten in der Mehrzahl männlich sind.
Bewegung für ein Paritätsgesetz
Inzwischen gibt es auch in Deutschland eine Bewegung für ein Paritätsgesetz, das eine repräsentative Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten festschreibt. Im Falle der Geschlechterverteilung wäre die 50:50. Auch hier sind wieder die Bayern vorn. Die Bayerische Verfassung bietet, einmalig in Deutschland, jeder Bürgerin und jedem Bürger die Möglichkeit einer Popularklage, bei der überprüft wird, ob ein garantiertes Grundrecht durch Gesetze und Bestimmungen verletzt wird.
Das Aktionsbündnis „Parité in den Parlamenten“ hat im November 2016 so eine Popularklage eingereicht. Die Antragstellerinnen und Antragsteller haben beantragt,
„wegen der fehlenden geschlechterparitätischen Ausgestaltung dieser Bestimmungen deren Verfassungswidrigkeit und Nichtigkeit festzustellen sowie den Gesetzgeber zu verpflichten, den verfassungswidrigen Zustand zu beseitigen und paritätische Wahlvorschlagsregelungen zu erlassen.“
Ablehnung in Bayern und von der AfD
Am 26. März 2018 hat der Bayerische Verfassungsgerichtshof den Antrag als unzulässig abgelehnt. Niemand werde durch die geltenden Regeln wegen seines Geschlechtes benachteiligt oder bevorzugt. In Ländern wie Frankreich, Irland, Polen, Portugal, Slowenien, Spanien und Griechenland gibt es längst Parité-Gesetze, weil ein freiwilliger Verzicht von Macht schwer durchzusetzen ist. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes über die Beschwerde der Antragsteller*innen, darunter auch Vereine und Verbände, steht noch aus.
Aber nicht nur in Bayern formiert sich ein Bündnis. In der Nacht zum 9. November 2018 hat die Fraktion der Linken im Bundestag einen Antrag für ein Paritätsgesetz – 50 Prozent Frauen in den Bundestag –, ins Parlament eingebracht.
Die AfD fand das verfassungsfeindlich. Aber die AfD hat ohnehin ein Frauenproblem. Der Anteil weiblicher Abgeordneter liegt bei der rechten Partei nur bei 10,6 Prozent. Nur 16 Prozent der AfD-Mitglieder sind Frauen. Kein Wunder bei dem Wahlprogramm, das eine Familienpolitik der 1950er Jahre zurücksehnt, bei Scheidungen das Schuldprinzip wieder einführen will, gegen Abtreibungen ist und bei Alleinerziehenden zwischen Schicksal oder selbstverschuldet unterscheiden möchte, letzteren soll eine staatliche Unterstützung nicht zustehen.
Wahlverhalten von Männern und Frauen
Bei der Bundestagswahl 2017 entschieden sich 16,3 Prozent der männlichen Wähler für die AfD und nur 9,2 Prozent der Frauen. Unter den Jüngeren sind es noch weniger. Interessant ist die Stimmverteilung nach Geschlechtern im Osten der Republik. Nach dem Mauerfall haben die Regionen, die vorher die DDR gebildet hatten, über zehn Prozent ihrer Bevölkerung verloren, zwei Drittel davon waren junge Frauen.
Kaum eine andere Gegend in der Welt weist vergleichbare Ungleichgewichte zwischen Männern und Frauen auf.
Die Regionen, aus denen die Frauen verschwunden sind, decken sich mit denen, in denen die AfD bei den letzten Wahlen überdurchschnittliche Erfolge aufzuweisen hatte. Bei AfD-Wählern im Osten ist der Hass auf Angela Merkel besonders ausgeprägt. Sie haben es der Ostdeutschen an der Spitze nie verziehen, dass sie in der neuen Gesellschaft Erfolg hatte und sie nicht, obwohl er nach ihrer Auffassung ihnen zugestanden hätte. So jedenfalls haben sie die Bundesrepublik verstanden. Als Land, in dem alles seine Ordnung hat, vor allem die patriarchale. Es war ein Trugschluss.
Wir brauchen eine radikalere Frauenbewegung
Aber die amerikanische Präsidentschaftswahl und der Rechtsruck in Europa haben uns noch einmal deutlich gemacht, dass die Freiheit der Frauen immer wieder verteidigt werden muss. Nichts ist selbstverständlich oder für immer durchgesetzt. Antje Schrupp schrieb im „Freitag“,
„dass alle Errungenschaften nur erhalten werden, wenn sie im gesellschaftlichen Leben verankert und konsequent gegen Angriffe verteidigt werden.“
Die Frauenbewegung, so Schrupps Schluss, muss wieder radikaler werden. Recht hat sie.
Buch-Tipp: Zuletzt erschienen von Annett Gröschner ist „Berolinas zornige Töchter - 50 Jahre Berliner Frauenbewegung“, Hrsg. FFBiZ, Berlin 2018 ISBN 9783981956115.



